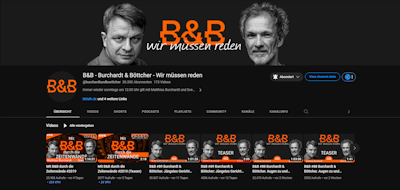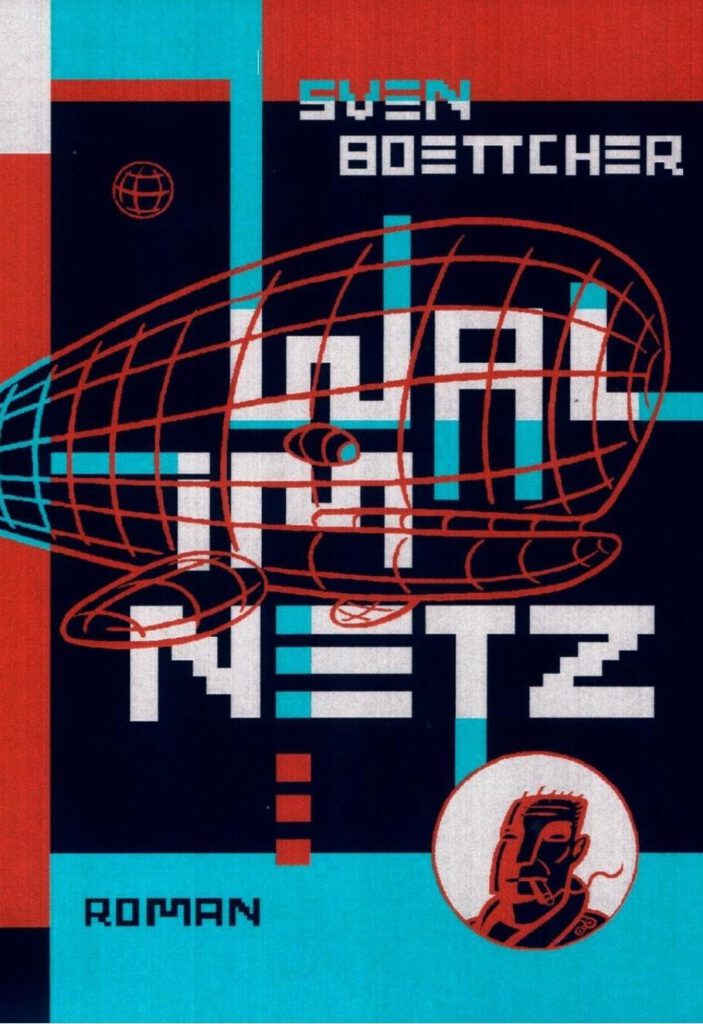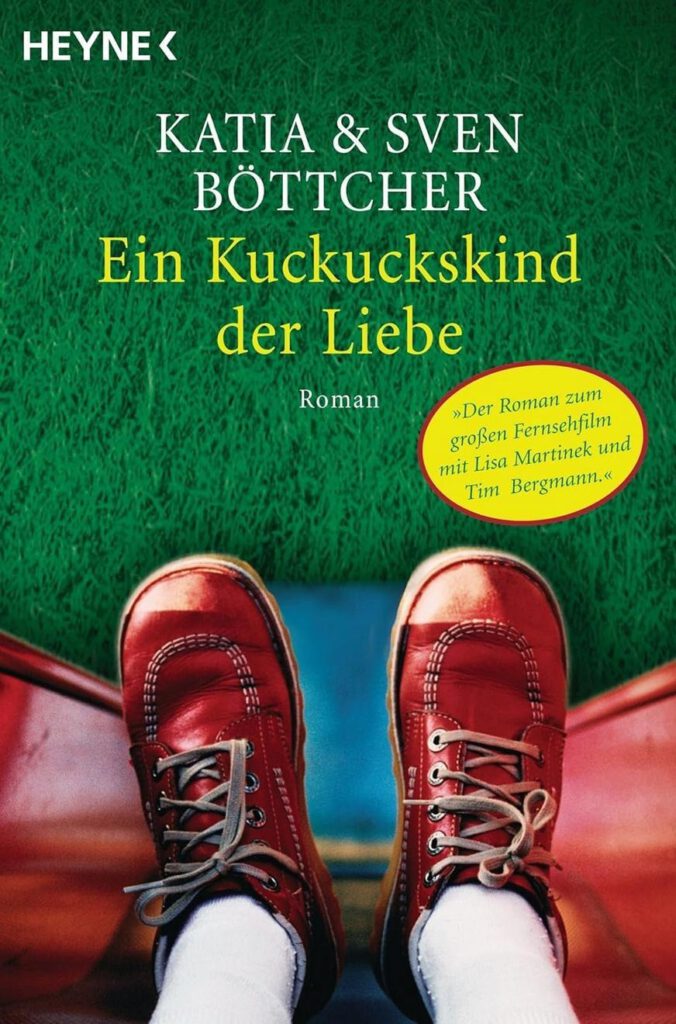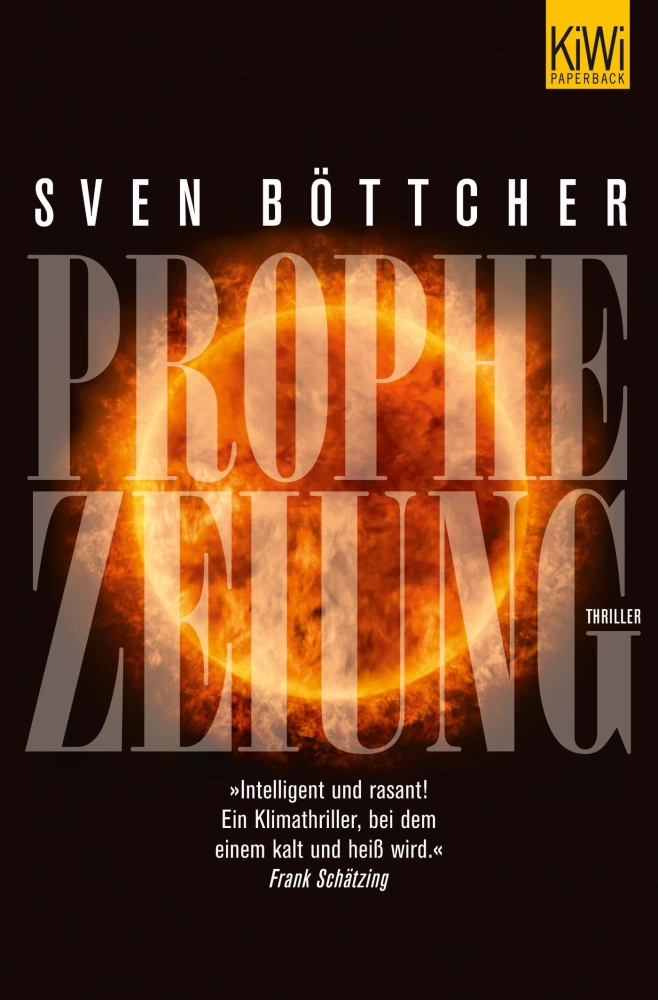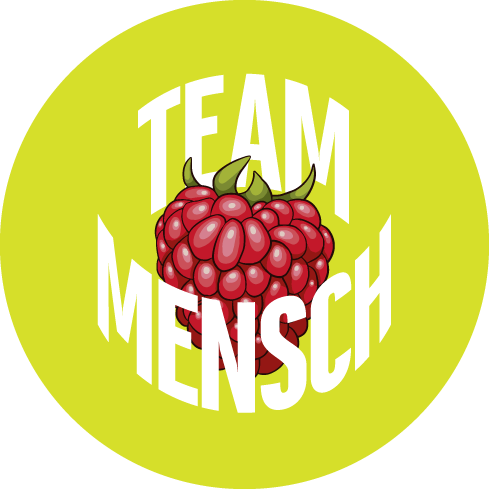Die Zombies sind nur Deko. Und zwar nicht Deko im Sinne von „hey, so sieht keiner unseren beschissenen Plot“, sondern (da der Plot brillant ist) lediglich bildstarke Platzhalter für „stell dir vor, du wachst in einer Welt auf, die du nicht verstehst – und die dich auf Schritt und Tritt umzubringen droht“. Man hätte fast ebensogut statt Zombies Viren besetzen können, fiese The-Ruins-Pflanzen oder feindliche Soldaten im Kriegsfall, aber die Zombies machen ihre Sache schlicht, gut und berechenbar, denn gegen sie ist per definitionem weder Kraut noch Argument noch sonstwas gewachsen. Die sind einfach tödlich und kennen nur: Fressen. Wird man gebissen, ist man binnen 2 bis 30 Minuten selber untot, tumb und tödlich. Ausnahmslos. Unheilbar. Punkt. Und es gibt sehr viele Zombies. Wenn das keine glasklare Rahmenbedingung ist.
Die wandelnden Toten sind allerdings in The Walking Dead nicht die Zombies, sondern jenes Dutzend Menschen, das den nicht erklärten Ernstfall überlebt hat und in seiner eben noch vertrauten, nun schlagartig komplett fremden und permanent lebensgefährlichen Welt zu überleben versuchen. Wozu, im Aussichtslosen? Gute Frage. Wird natürlich thematisiert, und zwar gebührend. Ist man aber mit der einen oder anderen Figur den ganzen Weg bis zum Pulsaderndurchschneiden gegangen, wieder zusammengenäht und mit einem neuen Rest nacktem Überlebenswillen erwacht, schließen sich gewichtige Fragen im Dutzend billiger an. Denn Krieg und Krise überbrücken nur in Groschenromanen oder B-Movies alle Gegensätze und schweißen Menschen zu funktionierenden Gruppen zusammen – jene, die wir hier erleben, sind wir und bis ins letzte Detail sauber und schmerzhaft nachvollziehbar erzählt. Niemand ist „gut“, niemand ist „böse“, kein Gutmensch ist ohne fragwürdige Fehler, kein grober Klotz ohne Nutzen, die aufgeworfenen Fragen sind mithin von solch existenzieller Wucht, dass sie sie ungebremst in Herz und Hirn einschlagen und all unsere Sicherheiten im Vorbeigehen pulverisieren. Hierin besteht die große und fast einmalige Leistung der dramaturgisch verantwortlichen Serienmacher, vom Erfinder der ursprünglichen Comic-Serie (Robert Kirkman) bis zum hauptverantwortlichen Creator der ersten Staffel (Shawshank Redemption-Regisseur Frank Darabont) und seinen Mitstreitern in den Abteilungen Buch, Regie und Produktion – und hierin besteht auch das Erfolgsgeheimnis des „Straßenfegers“, der trotz Ausstrahlung nur über den „creator-driven“ Kabelsender AMC in den USA alle Publikumsrekorde bricht und demnächst in die vierte Staffel geht: The Walking Dead ist keine Serie über Zombies, sondern eine Serie über das, was uns am Leben hält – physisch, aber erst recht psychisch -, kürzer: Was uns zu Menschen macht. Und was uns von herumtaumelnden Leichen unterscheidet, die nichts weiter können und wollen als fressen und weitertaumeln.
Unter der Faszination des Publikums dürfte so auch eine Portion Beklommenheit verborgen liegen, denn wenn sich schon kaum einer kritisch an die eigene korrigierte Nase fassen wird, so kommt man doch an der Frage nicht vorbei: „Hey, in welchem Film bin ich eigentlich? Hier, jetzt, täglich? Was sind das eigentlich für Leute um mich herum, die völlig sinnlos durchs Leben tappen und einfach nur fressen und weitertappen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Gewissen, an das man appellieren könnte, mit nur noch rudimentär funktionierendem Hirn? Und wie überlebt man hier: menschlich?“
Die Verzweifelten Noch-nicht-Zombies in The Walking Dead sind echte Menschen, mit all ihren Macken, Fragen, Neurosen und schwer vereinbaren Eigenarten, die auf diesem gräßlichen Terrain eigentlich nicht die geringste Überlebenschance haben. Trotzdem hoffen wir, die wir noch einen Rest Herz und Hirn besitzen, mit ihnen – auf Erlösung, möglichst im Leben selbst und nicht in einer besseren Welt danach. Jede der Figuren ist so perfekt gestaltet, dass jeder Tod einen tatsächlich berührt wie der eines Freundes oder Nachbarn, und wir taumeln angeschlagen, atemlos, schlecht schlafend mit dieser kleinen verzweifelten Schar weiter, denn sie sind in diesem großartigen Sinnbild unsere Stellvertreter. Die Fragen, mit denen sie konfrontiert werden, sind unsere, und die Antworten sind, hier wie da, alles entscheidend, sogar über das eigene Leben hinaus. Wer darf leben? Wer muss sterben? Unter welchen Umständen müssen wir töten? Wie viele Menschenleben ist das Leben eines einzelnen Menschen wert? Wer kann oder darf oder muss für wen entscheiden? Wer darf herrschen? Wer muss töten, um zu herrschen – und so mehr andere Leben zu retten als das eine, das er eigenhändig nimmt? Immer wieder, in jedem Dilemma, läuft alles auf dieselbe Wahrheit hinaus, die wir alle – rekordverdächtig einschaltend – ins uns widerhallen hören: Entscheiden wir uns richtig (oder am wenigsten falsch), ungeschriebenen, hohen Gesetzen folgend, bleiben wir am Leben, in einer unbarmherzigen, unheilbaren Welt. Entscheiden wir uns falsch, werden wir lebende Tote.
Die Zombies muss man einfach in Kauf nehmen. Es gibt keinen besseren Platzhalter. Dennoch sollte niemand auf die Idee kommen, Kindern oder Nervenschwachen die perfekten Masken und Effekte zuzumuten. Erwachsene hingegen schlafen schon wegen der aufgeworfenen Fragen nicht mehr ein, da richten die Alptraumbilder keinen zusätzlichen Schaden an.