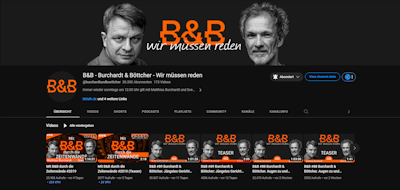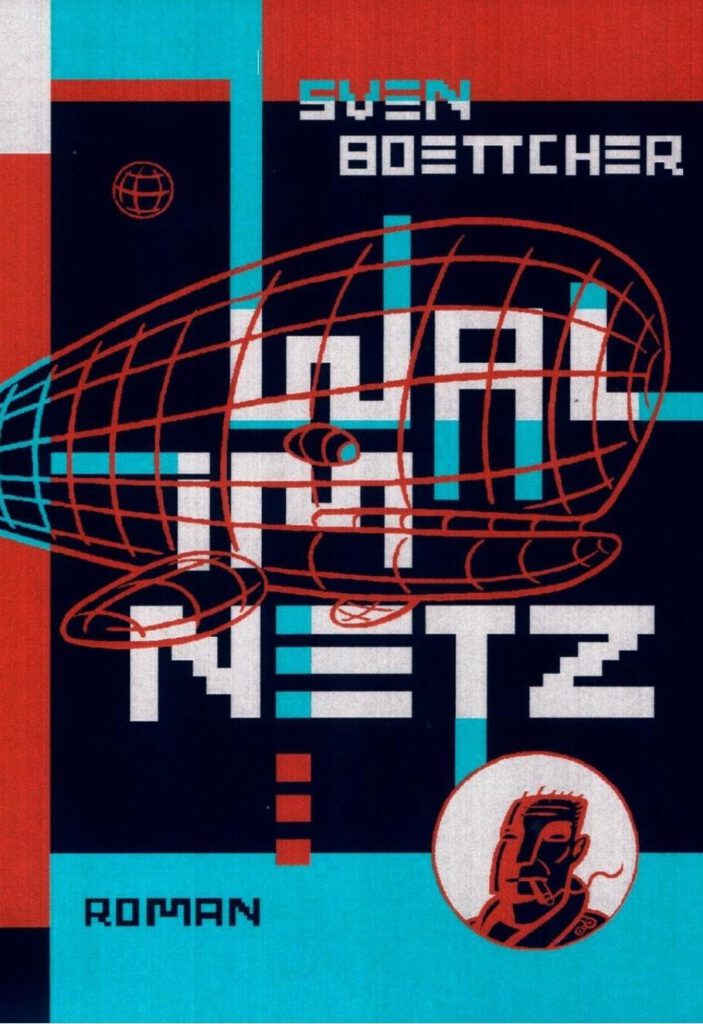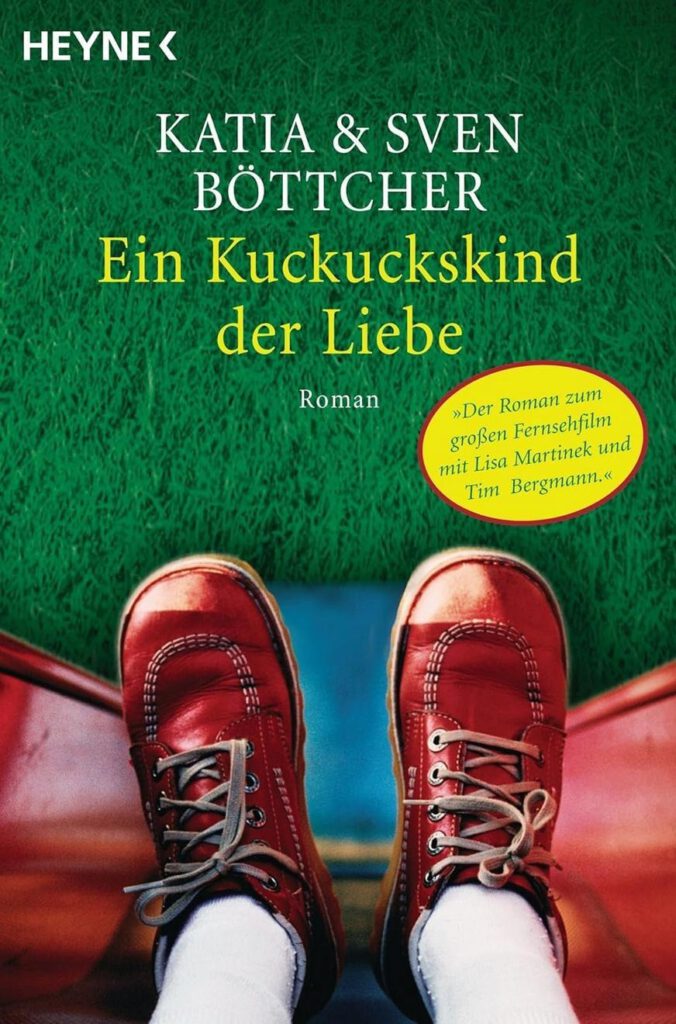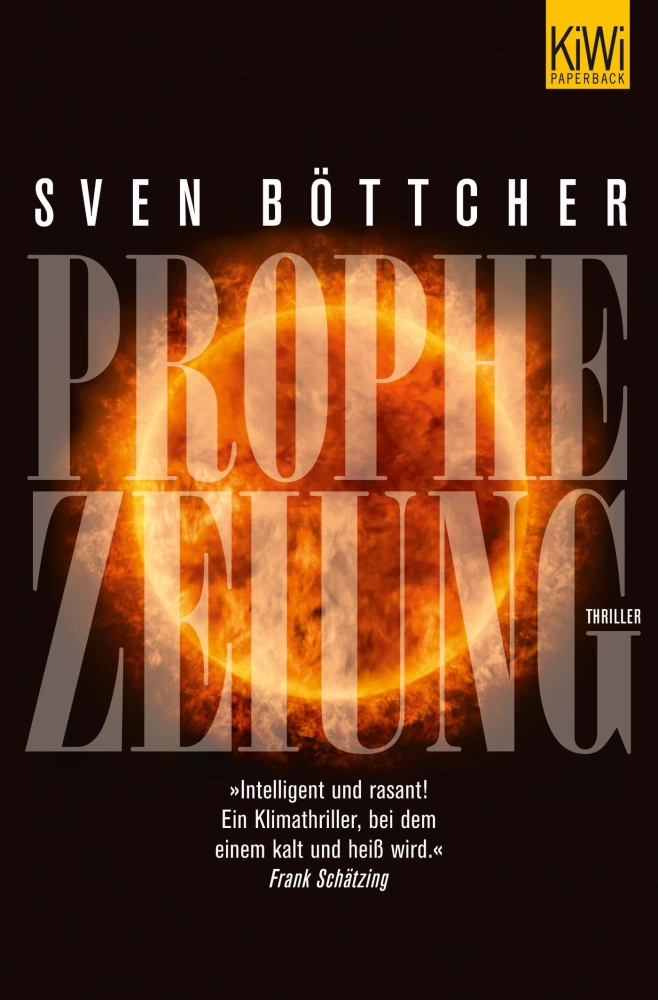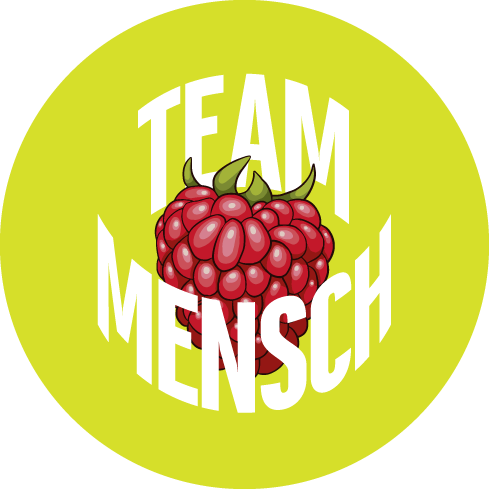Nachdem ich im Gespräch mit meiner Lieblingsbuchhändlerin kurz ins wüste Kopfschütteln geraten war wegen der von mir (an)gelesenen Sommerbücher, habe ich mir dann doch sagen lassen, JoJo Moyes Bestseller „Ein ganzes halbes Jahr“ sei „garantiert zwar keine Literatur, aber ein prima Schmöker“ – allerdings nur für Frauen. Sämtliche Bemerkungen zum fies kalkulierten Taschenspiel und billigen Effekthandel habe ich uns erspart und spare an dieser Stelle weiter, nur so viel sei mildernde Umstände halber gestattet: Chuzpe hat die Lady, denn sogar die meisten ebook-Autorinnen hätten sich nicht getraut, „Ziemlich beste Freunde“ einfach mit ner tumben Abziehbilder-RomCom und einer Prise Tabu („Sterbehilfe“) abgemischt auf den Publikumsteller zu legen. Also: Chapeau. Nicht mein Teller, äh, Tisch.
Ebenso wenig wie der Jungsbestseller „Silo“ (Wool) von Hugh Howey. Ich war zwar gewarnt (von den „Rezessionen“ aus dem amazon-Kosmos), dass sich dieses dem Web entwachsene Werk auf den ersten 100 Seiten etwas zäh liest, aber leider ändert sich daran bis zum Ende nichts. Und Howeys abschließende Drohung (nach 540, gefühlt 5000 Seiten), das sei ja erst der Auftakt zu seiner Saga gewesen, hat es wirklich in sich. Nicht auszudenken, was da noch an dystopischer Langeweile auf uns zukommt.
Daniel Suarez jüngsten Roman „Kill Decision“ kann man, anders als Howeys, zwar prima lesen, ohne wegzudämmern, allerdings vertut der von mir sehr geschätzte „Daemon“-Autor sich diesmal doch gehörig in der Wahl der Waffen. Dronen, die sich schwärmend selbstständig machen – das hätte ein wunderbarer SF-Roman werden können, kluge Warnungen wie die vom alten PKD oder Crichton oder Olsbergs „System“ weiterführend, aber Suarez verlegt sich leider auf permanenten Krach, also Die-Hard-Unsinn mit nervtötendem Klischeepersonal. Wird bestimmt ein 1A- Blockbuster für arbeitslose Ritalinabhängige, floppt aber deutlich unter jeder IQ-Latte durch. Was schade ist, weil das Thema so viel hergäbe.
Ganz und gar anders verhält es sich mit Thomas Glavinics Roman (?) „Das bin ich ja“, denn hier gibt das Thema (Glavinic) überhaupt nichts her. Glavinic schreibt zwar sehr komische sinnlose hin Dialoge, das allerdings nur gegen Ende des Textes. Der ganze Rest liest sich wie der lange Facebook-Eintrag eines der vielen, vielen Menschen, die ein sehr langweiliges Leben führen, das sie selbst für interessant halten. Verleger, Kulturschaffende und andere, die für Glavinic wichtig sind, waren und sein werden, kommen bestens weg bei der Bauchpinselei, das Feuilleton überschlägt sich vor Begeisterung und hat „stundenlang nur gelacht“, und ich habe das ganz bestimmte Gefühl: da will ich nie wieder stören. Und falls mal ein vergleichbar sterbensuninteressanter Abteilungsleiter der HUK Coburg „augenzwinkend“, „zum Totlachen“ über seine Branche schreibt, will ich das auch nicht lesen.
Dafür aber interessante Romane interessanter Autoren. Also zum Beispiel die von John Green, Lionel Shriver und Neil Gaiman. Gaiman erweist mit The Ocean At The End of The Lane neuerlich als unehelicher Enkel von King, Carroll und Lovecraft, die phantastische Story rührt wie gewohnt in phantastisch dunklen Untiefen von Kindheit und Jugend, und wer´s gern konkret und handfest hat, lässt gefälligst die Finger davon. Alle anderen staunen wie üblich über die einzigartige und beunruhigende Phantasiewelt des Herrn G. In der Frage, ob Jugendliche so was lesen sollten, gehen seine und meine Meinung allerdings weiterhin als Freunde auseinander. Ich hätte danach nächtelang nicht schlafen können, als junger Mensch, aber Neil behauptet ja steif und fest, seine Kinder könnten. Müssen die Gene sein.
Shriver (Lionel): Dank ihrer exzellenten und zurecht bestverkauften Romane Wir müssen über Kevin reden (der übrigens auch erschütternd präzis verfilmt wurde, falls jemand das verpasst hat) und Dieses Leben, das wir haben (So Much for That) hat sich zwischenzeitlich auch ein Verlag für The New Republic gefunden, ein Buch, das allerdings auf dem langen Weg aus Shrivers Schublade ein bisschen Staub angesetzt hat. Bildschön geschrieben ist es aber immer noch, und die entscheidende Frage, in wie weit unsere Medien die Welt erfinden, stellt sich heute genauso dringend wie Mitte des letzten Jahrzehnts, als der Stoff entstand. Dass Shriver mit ihrem neuen Roman Big Brother den Finger ganz wo anders hinlegt, nämlich ins amerikanische Familienfett, versteht sich allerdings auch von selbst, denn seit Kevin wissen wir ja, dass Shriver am besten dorthin geht, wo es weh tut. Da ich hier ausnahmsweise nicht spoilern will, belasse ich es beim schlichten Hinweis: Was würdet ihr denn machen, wenn euer geliebter kleiner Künstlerbruder nach vier Jahren Funkstille wieder bei euch auftauchte, mittellos, selbstbewusst – und unglaublich verfettet? Ihn zwei Wochen füttern und dann weiter seinem Exitus entgegenreisen lassen – oder die eigene Familie (die ja nur angeheiratet ist) für die Rettung und Gesundung des Blutsbruders aufs Spiel setzen? Was Shriver darüber in gewohnt großartigen Worten zu erzählen hat, tut weh. Von Anfang bis Ende.
Kompletter Nachzügler war ich bei John Green. Da nämlich „The Fault In Out Stars“ (Das Leben ist ein mieser Verräter) schon so lange auf den Bestsellerlisten steht, war ich sicher, dass es nichts taugen kann – und sehe mich vollständig korrigiert, nach der Lektüre. Ein Jugendbuch ist das wohl nur, weil Erwachsene bevorzugt irrelevanten Stuss lesen wie den von Glavinic, drum verlege ich mich ab jetzt gern auf Jugendbücher. „The Fault“ ist perfekt komponiert, schön geschrieben, schön relevant und ausgesprochen rührend. Und wer keine Angst hat, sich mit der wichtigsten Fragen des Lebens auseinanderzusetzen (also unserer Sterblichkeit), der greift bedenkenlos zu und wird reich belohnt. Anschließend lässt sich dann mit „An Abundance of Katherines“ einer der Stars-Vorgänger ebenfalls von Herzen empfehlen. Denn auch hier geht´s, gekleidet in eine durchaus komische jugendliche Road-Story, um eine Frage, die Glavinic und Co. garantiert nicht kennen: Ist es wirklich ein erstrebenswertes Ziel, einzigartig zu sein? Also eigentlich um die gleiche Frage wie in den „Stars“: da es „Unsterblichkeit“ nicht gibt – was stellen wir an mit unserem Leben vor dem Tod?